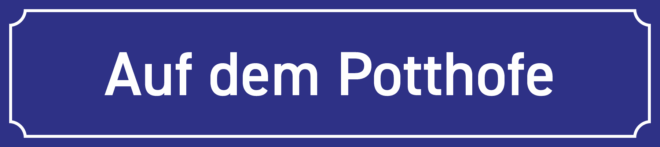| Verwaltungsbezirk | Burglesum |
| Ortsteil | Burg-Grambke |
| Postleitzahl | 28719 |
| Querstraßen | An der Beke Auf den Delben |
| Straßentyp | Anliegerstraße |
| Straßenlänge | rund 115 Meter |
Tief im Südwesten unseres Stadtteils, kurz vor dem Areal des Stahlwerks von ArcelorMittal Bremen, verläuft unser heutiger Serien‐Hauptdarsteller. Zur Erläuterung des Straßennamens bedienen wir uns auch in dieser Folge wieder einmal der Namensforschung bzw. der Namenskunde. Die Onomatologie oder Onomastik beschäftigt sich mit der Herkunft, Bedeutung und Verbreitung von Eigennamen. Hierzu zählen sowohl Personennamen (Vor- und Familiennamen) als auch Ortsnamen als Teilgebiet der Toponomastik. Aber nun genug der Germanistik.
In ihrem Straßenlexikon beschreibt schon Monika Porsch die Bedeutung des Straßennamens Auf dem Potthofe mit der „… Stelle in Burg‐Grambke, wo früher Erde ausgegraben und gepottet, d. h. gestopft wurde.“
Wofür steht potten oder stopfen nun genau? Und was wurde konkret wo und wofür ausgegraben?
Wurde etwa Gartenerde in Blumentöpfe verbracht und damit Pflanzen eingetopft? Bedeutet doch Pott im Niederdeutschen Tontopf und Potter steht für Töpfer (auch Pötter, Pöttger, Pottbacker, Pottbäcker, Pottbecker). In diesem Fall wohl nicht! Wir gehen gedanklich zunächst viele, viele hundert Jahre zurück. Diverse Hochwasser haben den Flusslauf der Weser immer wieder beeinflusst, verändert und geprägt. Insbesondere die schweren Überschwemmungen der Jahre 1570/1571 oder auch die Weihnachtsflut aus dem Jahr 1717 trugen ihren Anteil dazu bei. „Wer nich will dieken, de mutt wieken“ lautet ein altes Sprichwort aus dieser Zeit. Mit einem enormen Aufwand wurden Deiche gebaut und nach Sturmfluten immer wieder neu hergestellt. Kleinbauern (Köthner) erhielten für einen geringen Kaufpreis ein Stück Land, um im Gegenzug die angrenzenden Deiche in Ordnung zu halten. Deichbrüche kamen jedoch immer und immer wieder vor.
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dann die Weser in festere Bahnen gebracht. Vor den Deichen wurde Erde ausgegraben und für den Deichbau verwendet. Es bildeten sich weserseitig so genannte Groden. Diese dienten in der überschwemmungsfreien Zeit als Gemeinschaftsland der kleinen und armen Bauern und Köthner. Die Areale, von denen im großen Stil der Boden für die Deiche ausgepottet wurde, wurde zu „Pottkuhlen“ und „Potthöfen“. Und auch heute spricht man umgangssprachlich noch gern von Kinder, die im Schlamm oder Matsch spielen: „Die kleen in den Potten.“
Erschienen in: Lesumer Bote Nr. 124
Quellen:
Porsch M (2010). Bremer Straßenlexikon, Überarbeitete Gesamtausgabe, Carl Schünemann Verlag Bremen
Namen, die bald vergessen sein werden. Zeitungsartikel, Datum und Quelle unbekannt.
Hier werden morgen Schlote rauchen. Geschichten aus dem Raum um Mittelsbüren, Weser‐Kurier. 21.05.1955
Grambker Stadtteilportal. Grambke heute, gestern & vorgestern, https://bremen-grambke.de/Auf+dem+Potthofe, abgefragt am 02.10.2024